Die Atmos ist eine mechanische Pendeluhr mit Schneckenfeder und torsionsgesteuertem Pendel, deren Federhaus nicht manuell, sondern durch ein geschlossenes Blasebalg-System aufgezogen wird. Der Blasebalg (früher aus Glas, heute meist aus Metall) enthält ein Gasgemisch – seit 1936 überwiegend Ethylchlorid –, das sich bei Temperatur- und Luftdruckänderungen ausdehnt bzw. zusammenzieht.
Bereits eine Änderung von -1 °C oder +1 °C liefert genug Energie, um die Feder für etwa zwei Tage zu spannen. Da das Pendel der mechanischen Pendeluhr Jaeger-LeCoultre Atmos nur zwei Halbschwingungen pro Minute ausführt (zum Vergleich: eine klassische Pendeluhr schafft 120), liegt der Energiebedarf 250- bis 300-fach niedriger als bei herkömmlichen Tischuhren.
Geschichte
1928–1930: Jean-Léon Reutter und die Atmos 0/1
Der in Neuenburg tätige Ingenieur Jean-Léon Reutter präsentierte 1928 den ersten funktionsfähigen Prototyp „Atmos 0“. Ab 1929 übernahm die französische Compagnie Générale de Radio (CGR) die Fertigung der kommerziellen Atmos 1, die ein Balgsystem aus Quecksilber und Ammoniak nutzte.2
1935–1939: Übergang zu Jaeger-LeCoultre
Am 27. Juli 1935 erwarb Jaeger-LeCoultre (JLC) die Rechte, überarbeitete das Konzept grundlegend und stellte im Januar 1936 die Atmos 2 mit Ethylchlorid-Blasebalg vor. Wegen technischer Feinarbeit lief die Serienproduktion aber erst ab Mitte 1939 an.
1940er–1970er: Verfeinerung und Ausweitung
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Atmos zu einem Symbol schweizerischer Präzision. JLC brachte nummerierte Modellreihen (Atmos III–VIII) mit unterschiedlichen Gehäusen – von Art-Déco-Glaskästen bis hin zu vergoldeten Classique-Modellen – auf den Markt. Die Uhr fand ihren Platz in Diplomatenbüros, Staatsgäste-Geschenken und Designmuseen.
1983: Kaliber 540 und moderne Serien
1983 konstruierte JLC das Kaliber 540 (Seriennummern ab 600 000), das den Energiekreislauf nochmals stabilisierte und umfangreich in der heutigen Kollektion Verwendung findet. Seitdem erschienen limitierte Editionen, etwa mit Email-Zifferblättern aus dem Atelier des Métiers Rares oder Re-Editionen der Reutter-Glasglocke.
Bis 2025 wurden nach Schätzungen der Manufaktur über 500 000 Atmos-Uhren hergestellt.
Eigenschaften
- Energieeffizienz: Dank der extrem langsamen Pendelfrequenz (~0,5 Hz) genügt die tägliche Umgebungsenergie; ein Temperaturunterschied von 2 °C pro Tag kann eine Atmos theoretisch unbegrenzt betreiben.
- Präzision: Ab Werk ist eine Ganggenauigkeit von ±1 Minute pro Monat vorgesehen, was für einen derart energiearmen Antrieb bemerkenswert ist.
- Design-Vielfalt: Gehäuse aus Messing, vergoldeten Rahmen, Baccarat-Kristall oder modernem Saphirglas. Spezialserien zeigen kunstvolle Guillochierungen, Email-Malerei oder Skelettierungen.
- Wartung: Obwohl praktisch „selbstaufziehend“, benötigt eine Atmos etwa alle 20–25 Jahre eine Revision, hauptsächlich Schmierung und Dichtheitsprüfung des Balgs.
- Sammlerwert: Frühe Reutter-Modelle, Jubiläumseditionen (z. B. Millennium 2000) oder handgravierte Atelier-Stücke erzielen hohe Auktionspreise.
Gesundheitlicher Aspekt
Quecksilber und Ammoniak (Atmos 1)
Die allerersten Serien (1929–1935) setzten einen Balg mit Quecksilber-Ammoniak ein. Beschädigt der Besitzer das Balgsystem, kann Quecksilberdampf austreten; das ist toxikologisch relevant. Aufgrund dieser Problematik stellte JLC 1935 auf das deutlich weniger gefährliche Ethylchlorid um.
Radium-leuchtzifferblätter
Bis in die frühen 1960er kamen radiumhaltige Leuchtfarben zum Einsatz. Intakte Uhren gelten als relativ sicher, da das Glasgehäuse Alpha- und Beta-Strahlen abschirmt und die Gamma-Emission niedrig bleibt. Risiken entstehen vor allem beim Öffnen oder Restaurieren: Lose Leuchtfarbe kann eingeatmet oder verschluckt werden. Fachliteratur und Strahlenschutzuntersuchungen raten daher, radiumhaltige Atmos-Uhren nur von spezialisierten Restauratoren öffnen zu lassen und defekte Exemplare fachgerecht als radioaktiven Abfall zu entsorgen.
Ethylchlorid selbst ist leicht entflammbar (Flammpunkt −22 °C) und narkotisierend; sollte der Balg einmal undicht werden, empfiehlt die SUVA, den Raum sofort zu lüften und Funkenquellen zu meiden. Bei älteren Atmos-Uhren kann außerdem der Schmierstoff PCB-haltig sein, was eine fachgerechte Entsorgung als Sonderabfall erfordert.
Für Sammler gilt daher: Niemals in der Nähe offener Flammen, Heizkörper oder direkter Sonne ausstellen, weil thermische Spitzen den Innendruck drastisch erhöhen. Strahlenschutzfachstellen raten, radiumhaltige Ziffernblätter mit einem Handdosimeter zu überwachen; Werte über 1 µSv/h am Glas erfordern Abschirmkoffer oder Dekontamination. Nach Restaurierung sollten die Hände gewaschen und Staubreste abgesaugt werden, um jegliche Restkontamination zuverlässig zu entfernen hilft.
Seit knapp 60 Jahren verwendet Jaeger-LeCoultre weder Quecksilber noch Radium. Moderne Atmos-Uhren gelten als unbedenklich; Ethylchlorid ist hermetisch eingeschlossen und Radium wurde durch photolumineszierende Pigmente ohne Radioaktivität ersetzt.

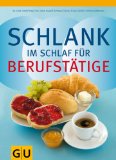




Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.